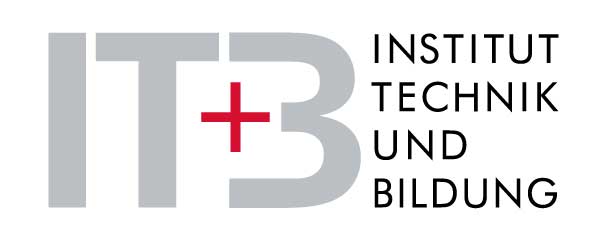Die Arbeit der Abteilung basiert auf der Kombination von Gestaltungsorientierung und Evidenzbasierung mit den Fokussen berufliche Ausbildung und berufliche Weiterbildung. Zentrale Forschungsschwerpunkte der Abteilung sind: (1) berufsbildende Kompetenzforschung, (2) arbeitsorientiertes Lernen und Lernen im Arbeitsprozess, (3) Digitalisierung von Arbeit und Lernen sowie die (4) Internationalisierung der Berufsbildung.
Überblick und Leitkonzept
Abteilungsleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler
Stellvertretende Abteilungsleitung: Dr. Daniela Ahrens
Sekretariat: Karen Trost
Leitkonzept
Gestaltungs- und Wirkungsforschung: In unserer Forschungsarbeit verfolgen wir einerseits einen gestaltungsbasierten Ansatz: Theoriegeleitet entwickeln, erproben und evaluieren wir innovative Lösungen mit und für die Praxis. Theorieanwendung und Praxisumsetzung werden andererseits kontinuierlich von einem Prozess der Theorieüberprüfung und -entwicklung begleitet, welcher evidenz- und wirkungsbasiert die Erkenntnisgewinnung ermöglicht und fördert.
Systemansatz: Ein Systemansatz erfordert, die Schnittstellen und Übergangsbereiche zu zeitlich vor- und nachgelagerten Bildungsbereichen zu berücksichtigen. Zum Systemansatz zählt für uns zudem und insbesondere, die vielfältigen Orte des berufsbildenden Lernens gleichberechtigt zu betrachten, womit unternehmensgebundenes Lernen (u. a. Lernortkooperation, betriebliche Weiterbildung) und multimediale Lernumgebungen ebenfalls in den Blick zu nehmen sind.
Mehr-Ebenen-Ansatz: In der Forschung verfolgen wir einen Mehr-Ebenen-Ansatz. Dieser umfasst die Gestaltung und Wirkungsanalyse von (1) berufsbildenden Lernumgebungen und -programmen (Mikro-Ebene) sowie (2) Bildungsorganisationen (Meso-Ebene) unter Berücksichtigung von (3) gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen und Entwicklungen (Makro-Ebene).
Forschung
Berufsbildende Kompetenzforschung
Kennzeichnend für dieses Forschungsfeld ist die Auseinandersetzung mit beruflichen Arbeitsprozessen und beruflichen Handlungsfeldern einschließlich deren Wandel. Hierbei geht es insbesondere darum zu analysieren und zu beschreiben, über welche Kompetenzen Facharbeiter*innen aktuell und zukünftig verfügen müssen, um erfolgreich in ihrem Beruf bestehen zu können. Diese Analyseergebnisse bilden die Grundlage zum einen für die Gestaltung von Berufen und die Entwicklung kompetenzorientierter Curricula und Prüfungen sowie zum anderen für die Früherkennung von Qualifizierungsbedarf. Je nach Berufsbildungssystem sind zusätzlich Sektoranalysen sowie Fallstudien (Unternehmen, Bildungsinstitutionen usw.) erforderlich.
Arbeitsorientiertes Lernen und Lernen im Arbeitsprozess
Anspruch der vom ITB vertretenen Berufsbildung ist es, dass diese sich nicht auf die Anpassung der Lernenden an neue Erfordernisse der Arbeitswelt reduziert. Vielmehr sollen (angehende) Fachkräfte in die Lage versetzt werden, Facharbeit verantwortlich mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Die ITB-Forschung richtet sich dementsprechend auf die Entwicklung, Durchführung und Evaluation kompetenzfördernder, (arbeits)prozessorientierter Ausbildungs- und Unterrichtsvorhaben (z. B. Lern- und Arbeitsaufgaben). Ein besonderer Schwerpunkt hinsichtlich (technischer) Lernumgebungen wird dabei auf den adressatengerechten Einsatz digitaler Medien gelegt. Darüber hinaus adressiert die Forschung auch Fragen der Lernortkooperation und der Ausbildungspartnerschaften sowie des Bildungsmanagements.
Digitalisierung von Arbeit und Lernen
Im Diskurs um „(Berufs-)Bildung 4.0“ oder „Lernen 4.0“ wird u. a. darauf verwiesen, dass sich durch die zunehmende Digitalisierung auch die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen und -formaten ändert. So bieten Mobile Learning, Augmented, Virtual oder Mixed Reality, MOOCs, Gamification, Learning Analytics usw. neue Möglichkeiten für selbstgesteuertes, kooperatives und vernetztes Lernen. Die Gestaltung und Weiterentwicklung mediengestützter Lehr- und Lernangebote im Forschungsfeld erfolgt auf der Grundlage berufspädagogischer Konzepte auf drei Ebenen: Auf der organisatorischen Ebene werden Fragen der betrieblichen und schulischen Einbettung digitaler Medien und deren Konsequenzen für das Verhältnis von Arbeit und Lernen analysiert. Zweitens auf der Ebene der Lehr- und Lernprozesse wird unter Bezugnahme auf mediendidaktische Ansätze das Potenzial digitaler Medien untersucht, Lehr- und Lernprozesse anders zu gestalten und zu organisieren. Drittens geht es auf der technischen Ebene um die Entwicklung medientechnischer Lernumgebungen unter Berücksichtigung sich wandelnder Sozialisations- und Nutzungsbedingungen. Adressiert werden hier neben der (beruflichen) Aus- und Weiterbildung auch vorberufliche und (außer-)schulische Bildungsbereiche.
Internationalisierung der Berufsbildung
In vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas finden derzeit Reformbemühungen statt, die weitgehend vollschulischen Berufsbildungssysteme um betriebliche bzw. arbeitsplatzbezogene Elemente zu erweitern. Vorbild dieser Reformen ist in der Regel das Duale System der Berufsausbildung in Deutschland. Einen zweiten Trend bilden Reformen und Entwicklungen in Deutschland im Zuge des europäischen Integrationsprozesses. Parallel zu diesen politischen Prozessen ist festzustellen, dass deutsche Unternehmen insbesondere im Ausland wachsen, während die Berufsausbildung und die Berufsbildungsforschung in Deutschland trotz dieser Rahmenbedingungen weitgehend national ausgerichtet sind. In der ITB-Forschung werden die skizzierten Trends und die sich hieraus ergebenden Bedarfe, Innovationen und Entwicklungen sowohl national, international als auch vergleichend untersucht.
Projekte
Diese Projekte werden von der Abteilung Prof. Dr. Dr. h.c. Gessler betreut, durchgeführt und verantwortet.